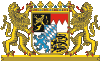Forschungs- und Innovationsprojekt Quasi-Holz
Qualitätssicherungsmaßnahmen für weniger mineralische Verschmutzung & besserer Verbrennung von Holzbrennstoffen

Bild: Tobias Hase/StMELF
Eine Kontamination von Brennstoffen mit Mineralboden während der Bereitstellung führt zu Störungen an der Feuerungsanlage, erhöhten Staubemissionen, einem erhöhten Ascheanfall und zur Schlackebildung. Sie hat somit Konflikte zwischen Anlagenbetreiber und Brennstofflieferant zur Folge. Hinzu kommen ökonomische Nachteile bei der Brennstoffabrechnung nach Masse, da hierbei, je nach Verschmutzungsgrad, größere Mengen an nicht brennbarem Material pro Lieferung bezahlt werden müssen.
Ziel
Die übergeordneten Ziele des Forschungsprojektes „Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Verringerung der mineralischen Verschmutzung und zur Verbesserung der Verbrennung von Holzbrennstoffen“ (Quasi-Holz) sind:
- Entwicklung und Integration einer praxistauglichen Qualitätssicherungsmethode zur Identifizierung von mit Mineralboden verunreinigten Brennstoffproben bei der Warenannahme in der Praxis
- Bewertung kritischer Verschmutzungsgrade von biogenen Festbrennstoffen (Hackschnitzel, Pellets) auf die Verbrennung und den damit verbundenen Schäden an der Anlage (Schlackebildungen, Korrosion) sowie deren Umweltwirkungen (z.B. Emissionen)
Aus den Ergebnissen lassen sich zahlreiche Empfehlungen für die Praxis ableiten, sowohl hinsichtlich der Einhaltung der strengen Grenzwerte der Stufe 2 der 1. BImSchV als auch hinsichtlich des betrieblichen Qualitätsmanagements. Daneben werden grundlegende Erkenntnisse zur verbrennungstechnischen Wirkung von mit Mineralboden verschmutzten Holzbrennstoffen erarbeitet.
Das Projekt ermöglicht es, bestehende Prozessketten bei der Hackschnitzelbereitstellung zu optimieren und so den Hackschnitzelmarkt weiter zu professionalisieren. Durch die Verbesserung der Prozesskette und durch die daraus folgende flächendeckend sauberere und störungsärmere Verbrennung kann die regionale Nutzung holziger Biomasse weiter gefördert und in ihrer Verbreitung eine höhere Akzeptanz gewinnen.
Methoden
Im Forschungsvorhaben basieren insbesondere auf vorangegangenen Projektergebnissen zur Brennstoffqualität und Brennstoffindizes, zur Qualitätssicherung von Holzbrennstoffen und zum Verbrennungsverhalten der Brennstoffe in Kleinfeuerungsanlagen. Die Untersuchungen finden in Labor- und in Feldversuchen sowie am Feuerungsprüfstand des TFZ statt. Sie umfassen folgende Arbeitspakete:
- Analysen zur Allgemeingültigkeit der im Projekt „Optimale Bereitstellungsverfahren für Holzhackschnitzel“ entwickelten Brennstoffindizes zur Beurteilung der mineralischen Verschmutzung von Holzbrennstoffen
- Vergleich von Labormethoden zur Quantifizierung von mineralischer Verschmutzung
- Modellierung der Verschmutzungsgrade mittels der Brennstoffindizes
- Anwendung der Indizes in der Qualitätssicherung, z.B. mittels mobiler RFA
- Einfluss des Mineralbodens auf die Verbrennung
Vorbereitung und Vorversuche zur Evaluierung der Methode
Durchführung der Versuche
Ergebnisse
- Schön et al., 2021 - Contamination of wood chips with mineral soil - fuel quality and combustion behavior - e-EU BC&E
 1,0 MB
1,0 MB
- Kuchler et al., 2019 - Contamination of wood pellets with selected mineral soils - Fuel quality and combustion behaviour - EU BC&E Lisbon
 1,1 MB
1,1 MB
- Zimmermann et al., 2019 - Practical Application of EDXRF Technology to Determine the Chemical Quality of Wood Chips – EU BC&E Lisbon
 1,0 MB
1,0 MB
- Contamination of wood chips with mineral soils - fuel quality and combustion behaviour - ForMec Sopron 2019
 4,5 MB
4,5 MB
Projektinformation
Projekttitel: Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Verringerung der mineralischen Verschmutzung und zur Verbesserung der Verbrennung von Holzbrennstoffen (Quasi-Holz)
Projektleitung: Dr. Daniel Kuptz
Projektbearbeitung: Carina Kuchler
Projektlaufzeit: 01.09.2017–31.12.2020
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Projektpartner: LWF – Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Förderkennzeichen: KS/17/03