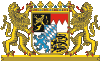Aktualisierte internationale Studie des IEA Bioenergy-Task 32 (Combustion):
Bestandsaufnahme nationaler Strategien zur Verringerung von Auswirkungen häuslicher Holzheizungen auf die Luftqualität (zweite überarbeitete und erweiterte Auflage, Mai 2025)
von Hans Hartmann, Christoph Schmidl, Sebnem Madrali, Thomas Nussbaumer, Peter Zotter, Morten Tony Hansen, Valter Francescato, Jaap Koppejan, Øyvind Skreiberg, Jonas Dahl, David L. Nicholls
Deutschsprachige Zusammenfassung
Die Verringerung der Luftverschmutzung ist ein wichtiges gesellschaftliches Ziel, und es werden derzeit große Anstrengungen unternommen. In den letzten 30 Jahren wurden erhebliche Fortschritte erzielt, aber die Holzverbrennung ist in den Mitgliedsländern der IEA Bioenergy nach wie vor eine bedeutende Quelle der Luftverschmutzung, insbesondere für Kohlenmonoxid- (CO) und Feinstaubemissionen (PM)-Emissionen.
Wenn die Emissionen aus der Holzverbrennung von privaten Haushalten stammen, sind die Probleme am schwierigsten zu lösen. Es gibt viele Einflussfaktoren: Die denn die Ofen- und Kesseltechnik ist variantenreich, es gibt viele Arten von Holzbrennstoffen, und die Qualität des Holzbrennstoffs variiert in vielerlei Hinsicht. Darüber hinaus sind Fertigkeiten der Nutzer und Nutzerinnen im Umgang mit der Anlage sehr unterschiedlich, spielen aber eine große Rolle bei der Beeinflussung der Emissionswerte. Aus diesen Gründen sind die Schadstoffemissionen aus den Anlagen der privaten Haushalte am höchsten. Daher liegt der Schwerpunkt dieses Berichts auf den Biomasse-Kleinfeuerungen. In diesem Bereich müssen politische Entscheidungsträger oder Institutionen, die für die Kontrolle der Luftqualität zuständig sind, eine unüberschaubare Anzahl von Optionen für Abhilfemaßnahmen koordinieren. Bei einer solch anspruchsvollen Aufgabe kann es hilfreich sein, sich von Erfolgsgeschichten aus anderen Regionen inspirieren zu lassen.
Dieser kürzlich aktualisierte und deutlich erweiterte Bericht stellt nationale Ansätze für Emissionsminderungsstrategien im Bereich der Holzverbrennung in Privathaushalten in ausgewählten Mitgliedsländern der IEA-Bioenergy zusammen. Die dargestellten Informationen wurden in strukturierter Weise mittels eines detaillierten Fragebogens länderspezifisch erhoben. Wo es möglich war, bietet der Bericht über aktive Weblinks auch direkten Zugang zu den ursprünglichen Informationsquellen. Entscheidungsträger können so alle Informationen leicht zurückverfolgen und ihre eigene Strategie stützen.
Zehn Länder haben sich an der Zusammenstellung der Informationen beteiligt: Österreich, Kanada, die Schweiz, Deutschland, Dänemark, Italien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die USA. Der Bericht gliedert sich in drei große Teile. Teil 1 zeigt einige einfache Statistiken zum aktuellen Stand der Holzverbrennung in ausgewählten Ländern. Teil 2 bildet den Hauptteil des Berichts, in dem ausführliche Informationen zu relevanten Maßnahmen für jedes der ausgewählten Länder zusammengestellt werden. Dies geschieht in 16 Unterkapiteln, z. B. zu Ofentauschmaßnahmen, regionalen Beschränkungen für Öfen, Verschärfung von Emissionsgrenzwerten, Vor-Ort-Inspektionen von Öfen oder Kesseln, Gütesiegeln, Schulungen und Information. In Teil 3 schließlich wird die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verringerung holzbasierter Schadstoffemissionen kurz bewertet und von den beteiligten Experten nach eigenem Ermessen priorisiert.
Einige ausgewählte Highlights der Studie:
- Nationale Austauschprogramme für alte Öfen wurden in Deutschland und in Dänemark durchgeführt. Aber es gab auch viele regionale und zeitlich begrenzte freiwillige Austauschprogramme, manchmal auch auf kommunaler Ebene.
- Verbote für die Verwendung von Holzbrennstoffen sind ein weit verbreiteter Ansatz. Solche Beschränkungen werden in allen beteiligten Ländern angewandt, entweder als zeitlich begrenzte oder als dauerhafte Maßnahme. Verbrennungsverbote werden meist auf regionaler Ebene umgesetzt. Manchmal ist ein Verbot von Holzbrennstoffen von den aktuellen Immissionsbedingungen abhängig. Oder die Einschränkung wird als vorübergehender Vorschlag kommuniziert, der bei kritischen Wetterbedingungen gemacht wird, wie z.B. der "Stookalert" (Heizungsalarm) in den Niederlanden.
- Die Verschärfung von Emissionsgrenzwerten hat in den meisten Ländern eine lange Tradition. So haben beispielsweise Österreich und Deutschland in den letzten Jahren insgesamt dreimal die Grenzwerte verschärft. Bei den europäischen Grenzwerten (Ökodesign-Richtlinie) mussten alle europäischen Länder mitziehen, und auch einige Nicht-EU-Länder wie die Schweiz und Norwegen sind gefolgt. In den USA wurden die Emissionsgrenzwerte für zertifizierte Öfen und für Warmwasserbereiter ebenfalls in zwei Schritten verschärft.
- Öffentliche Anreize für Investitionen in neue Geräte waren in den letzten Jahren üblich, bei Zentralheizungskesseln, aber teilweise auch Einzelraumfeuerungen. Bei Abwrackprämien war es in vielen Ländern wichtig, dass die weitere Nutzung des alten Ofens effektiv ausgeschlossen wird (z.B. in Kanada oder Dänemark). Bei Heizkesseln sind die Subventionen meist nicht an Bedingungen geknüpft, außer in Deutschland, wo ein langfristiges Subventionsprogramm den Weg für einen fortschrittlichen Stand der Technik geebnet hat, indem strenge, ehrgeizige Emissionsklassen oder obligatorische technische Kesselmerkmale eingeführt wurden. In den USA wurden auch Steuergutschriften für den Kauf und die Installation neuer Holzöfen eingeführt.
- Regelmäßige Vor-Ort-Kontrollen sind in den meisten der beteiligten Länder üblich, sowohl für Holzöfen als auch für Zentralheizungskessel. In den meisten Fällen sind hierbei die Schornsteinfeger beteiligt, sie sind aber meist nur zur Gewährleistung der Sicherheit vor Ort. In Österreich, Deutschland, der Schweiz und Dänemark wird der Ofen aber auch regelmäßig auf Funktion und Schäden überprüft. In Deutschland ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger verpflichtet, den Ofenbesitzer alle 3 bis 4 Jahre über die ordnungsgemäße Nutzung des Ofens zu informieren, die Holzfeuchte zu prüfen und bei Heizkesseln eine wiederkehrende Messung der CO- und Staubemissionen durchzuführen.
- Um fortschrittliche Technologien hervorzuheben, gibt es zahlreiche Gütesiegel für Öfen und Kessel, sie beruhen meist auf den Ergebnissen von Typprüfungen durch zertifizierte Stellen. Nur der deutsche "Blaue Engel" für Kaminöfen basiert auf einem speziellen Prüfprotokoll, das den praktischen Einsatz realitätsnah widerspiegelt.
- Die Informationskampagnen für die Öffentlichkeit sind sehr vielfältig und umfassen eine Reihe interessanter Ansätze. Neben Broschüren und Info-Websites gibt es Online-Kurse für Kaminofenbenutzer (Kanada), Citizen-Science-Trailer, die Kaminofenbenutzer dazu einladen, den richtigen Betrieb praktisch zu erleben (Österreich), Lehrvideos über den Kaminofenbetrieb sind verfügbar (Schweiz, Deutschland), oder Wissenschaftler leiten Diskussionsforen über die Technologie und den Gebrauch von Holzöfen (Norwegen). In Schweden werden alle kleinen Holzfeuerungsanlagen in einem Kataster erfasst, um das Immissionsreduktionspotenzial zu ermitteln. In den USA werden viele technische Informationen auch über Web-Blogs zur Verfügung gestellt.
Projektleitung:
Dr. Hans Hartmann
Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohrstoffe (TFZ)
Tel.: 09421 300210
E-Mail: hans.hartmann@tfz.bayern.de
Internet: Technologie- und Förderzentrum (TFZ) - Biogene Festbrennstoffe ![]()