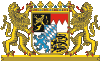Forschungs- und Innovationsprojekt SilphieGuide
Gärrestdüngung und umweltschonende Umbruchmethoden in Durchwachsener Silphie

Drohnenaufnahme Gärrestdüngung
Die Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.) wird als alternatives Substrat zur Biogaserzeugung eingesetzt, so dass eine Düngung der Dauerkultur mit Gärresten sinnvoll ist. Aktuelle Versuche des TFZ zeigen, dass die Stickstoffverwertung von Gärrestgaben noch verbesserungswürdig ist und weitere Optimierungsansätze untersucht werden sollten. Hinsichtlich des Umbruchs von Silphiebeständen wurden erste Erfahrungen gemacht, aber auch verschiedene Probleme erkannt, zu denen ebenfalls weiterer Forschungsbedarf besteht. Durch geeignete Verfahren soll der Herbizideinsatz reduziert und Bodenerosion vermieden werden, so dass im gesamten Anbauverfahren von Silphie eine höchstmögliche Umweltverträglichkeit erreicht wird.
Video-Projektvorstellung
Aktivierung erforderlich
Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.
Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.
Ziel
Methode
Die Ziele des Projekts werden mit Parzellenversuchen am Standort Straubing und Versuchen auf geeigneten Praxisflächen (Einsatz von Schlitzscheibenverteilern, ggf. öffentliche Vorführung) erarbeitet:
- Untersuchung verschiedener Strategien der Stickstoffdüngung von Silphie mit Gärresten
- Prüfung der Einsatzeignung von Schlitzscheibenverteilern in Silphiebeständen für eine emissionsarme Gärrestausbringung
- umfangreiche Erhebungen zu Nährstoffgehalten und -abfuhren im Silphieanbau zur Beurteilung der Nährstoffkreisläufe
- weitere Versuche zum Umbruch von Durchwachsener Silphie u. a. im Hinblick auf den Umbruchzeitpunkt, die Stickstoffnachlieferung und eine mechanische Durchwuchsbekämpfung
- Vermittlung der Ergebnisse an Praxis und Öffentlichkeit durch verschiedene Formen des Wissenstransfers
Ergebnisse der Versuchsjahre 2022–2024
N-Düngung von Durchwachsener Silphie
- deutliche Zunahme der Trockenmasseerträge durch N-Düngung bis zu einem Niveau von 150 kg N/ha (mineralisch)
- potenziell hohe Gefahr von Ammoniakverlusten und verminderter N-Düngewirkung bei Gärrestdüngung in Silphie durch teilweise schlechte Infiltration der Gärreste und fehlende Einarbeitungsmöglichkeit
- Bodenlockerung mit einer Reihenhacke zwischen den Silphiereihen vor der Gärrestausbringung als Möglichkeit zur Verbesserung der Infiltration und Absicherung der N-Verwertung von Gärresten
- wie im Vorgängerprojekt: schlechtere Düngewirkung bei einer Gärrestdüngung im Herbst im Vergleich zu einer Frühjahrsgabe
- tendenziell geringere Erträge bei Zusatz eines Nitrifikationshemmstoffs zur Gärrestdüngung (Frühjahr)
- sehr niedrige Nmin-Mengen im Boden nach Ernte und zu Vegetationsende unabhängig von der Düngung: Silphie bietet Vorteile für Gewässerschutz
- aufgrund des frühen Austriebs profitiert Silphie stärker von einem hohen N-Angebot aus einer Düngung im Frühjahr als beispielsweise Mais: Gärreste im Frühjahr ausbringen und auf geringe N-Verluste achten
Emissionsarme Gärrestausbringung in Durchwachsener Silphie
- bei Einsatz eines Schlitzgeräts im Frühjahr angestrebte Schlitztiefe von mind. 5 cm auch bei feuchteren Bodenverhältnissen nicht erreicht, Schlitztiefe im Versuch: ca. 3 cm
- dadurch keine Verbesserung der N-Düngewirkung im Vergleich zur Schleppschlauchtechnik am Versuchsstandort
- keine Pflanzenschäden durch Ausbringung mit Schlitztechnik auch bei sehr später Düngung (Ende April)
- Gärrestausbringung mit Schlitztechnik schadet Silphie nicht, aber nur bei ausreichender Schlitztiefe Verbesserung der N-Verwertung zu erwarten
Nährstoffkreisläufe im Silphieanbau
- kein Effekt einer Bor-, Schwefel, Calcium- oder Kalkdüngung auf den Silphieertrag nachweisbar (zwei Standorte: lehmiger Sand + Löss, keine Mangelstandorte)
- S-Aufnahme von Silphie relativ gering → unter normalen Bedingungen keine Düngung erforderlich
- Silphie weist sehr hohe Kalium-, Magnesium- und Calciumabfuhr auf
- ca. 2,3 kg K2O/dt TM; 0,65 kg MgO/dt TM; 2,8 kg CaO/dt TM
- keine höhere Mikronährstoffabfuhr im Vergleich zu Silomais
- wegen hoher Abfuhr basisch wirksamer Kationen (K, Mg, Ca) bei Silphie auch bei Gärrestdüngung auf Erhalt ausreichender Bodengehalte und regelmäßige Kalkung achten
Umbruch von Durchwachsener Silphie
- ca. 8 bis 10 cm tiefes Fräsen reduziert Triebkraft von Silphiedurchwuchs in der Folgekultur: geringerer Herbizidaufwand erforderlich und weniger Durchwuchsbesatz
- im Gegensatz zum Vorgängerprojekt kein schlechteres Wachstum von Wintertriticale nach Umbruch von Silphie im Herbst mit einer Fräse im Vergleich zum Umbruch mit Pflug
- Gefäßversuch: nach dem Umbruch von Silphie Potential für N-Immobilisation als Folge des Abbaus der Wurzelreste mit weitem C/N-Verhältnis vorhanden: vermutlich Ursache für schlechteres Wachstum von Triticale im Vorgängerprojekt
- geringe N-Nachlieferung im ersten Jahr nach dem Umbruch von Silphie auf einem Lössstandort, zunächst sogar eher N-Immobilisation
- erhöhte N-Nachlieferung auch bereits im Herbst nach dem Umbruch von Silphie auf einem sandigen Standort
- auf leichten Standorten Umbruch von Silphie vor Sommerungen erst im Frühjahr
- bei Umbruch nach der Ernte: Anbau von Kulturen mit einem hohen N-Aufnahmevermögen bis Vegetationsende
- nach dem Umbruch von Silphie je nach Standort sowohl Potential für geringe als auch hohe N-Nachlieferung vorhanden: N-Düngung in Folgekultur reduzieren, Bestand der Folgekultur beobachten und bei Bedarf nachdüngen
Einblicke in das Projekt
Weiterführende Informationen
- Rekultivierung
- Optimierung der Stickstoffdüngung von Durchwachsener Silphie
- TFZ-Merkblatt: Düngung von Durchwachsener Silphie
 4,2 MB
4,2 MB
- TFZ-Merkblatt: Umbruch von Durchwachsener Silphie
 2,7 MB
2,7 MB
- Projektübersicht SilphieGuide
 383 KB
383 KB
- TFZ-Bericht 89: Gärrestdüngung und umweltschonende Umbruchmethoden in Durchwachsener Silphie

Projektinformationen
Projettitel: Gärrestdüngung und umweltschonende Umbruchmethoden in Durchwachsener Silphie
Projektleitung: Dr. Maendy Fritz
Projektbearbeitung: Sebastian Parzefall, Stefan Wiesent, Michael Grieb
Laufzeit: 01.01.2022–31.12.2024
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF)
Förderkennzeichen: G2/N/21/07